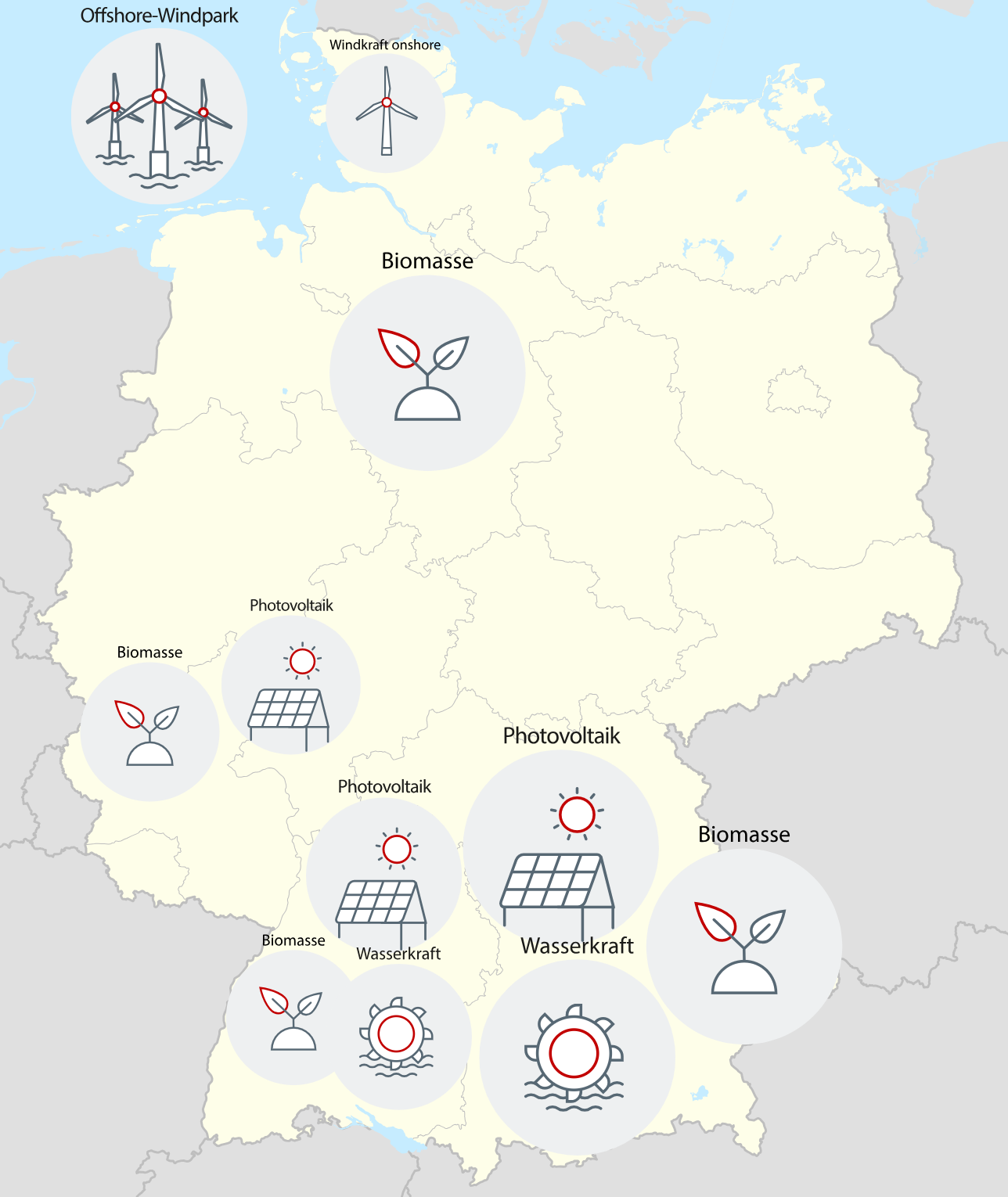Wie funktioniert ein Wasserkraftwerk?
Wasser besitzt zwei Energieformen: potenzielle Energie durch Höhenunterschiede und kinetische Energie durch Fließgeschwindigkeit in Bächen und Flüssen. Ein Wasserkraftwerk nutzt diese Energien, um über eine Turbine und einen Generator Strom zu erzeugen. Wasserkraft zählt zu den am längsten genutzten und effizientesten Formen der erneuerbaren Energie – und spielt damit eine wichtige Rolle bei der Energiewende. Ihr Wert zeigt sich besonders in Kombination mit Stromspeicherlösungen.
Die Wasserkraft ist eine natürliche Ressource, die über Generationen hinweg für eine zuverlässige und nachhaltige Stromversorgung genutzt werden kann.
Voraussetzungen für die Nutzung der Wasserkraft sind genügend Wasser und eine ausreichende Fallhöhe. Durch das Gefälle können in Fließgeschwindigkeit Wasserturbinen betrieben werden. Oft sind Kraftwerke dort entstanden, wo zum Hochwasserschutz, zur Schaffung ausreichender Wassertiefe für die Schifffahrt oder für die Trinkwasserversorgung Stauanlagen errichtet wurden.

Coffeinlix/Shutterstock
Wasserkraftwerke im Überblick
Laufwasserkraftwerke
Hier fließt das Wasser direkt durch die Anlage und treibt Turbinen an. Diese Kraftwerke erzeugen kontinuierlich Strom. Laufwasserkraftwerke stehen meist an großen Flüssen.
Speicherkraftwerke
Die Anlagen sammeln Wasser aus Regen und Schneeschmelze in Staubecken. So kann das Wasser über kurze oder längere Zeit gespeichert werden. Bei Bedarf wird es dann genutzt, um flexibel Strom zu erzeugen.
Pumpspeicherkraftwerke
Pumpspeicher werden oft ebenfalls zu den Wasserkraftwerken hinzugezählt, hier muss man aber differenziert vorgehen. Reine Pumpspeicher nutzen die potenzielle Energie der Lage. Wasser dient hier lediglich als Speichermedium für die bezogene elektrische Energie, indem mittels elektrischer Pumpen Wasser aus einem niedrigen Reservoir in ein hohes Reservoir gepumpt wird. Bei Bedarf wird das Wasser wieder in das niedrige Reservoir abgelassen und treibt dabei Pumpen an. Ergänzend gibt es auch Pumpspeicher mit natürlichem Zufluss in das obere Speicherbecken, bei diesen Anlagen wird auch nebenbei elektrische Energie wie in Wasserkraftwerken neu erzeugt, ohne dass zuvor elektrische Energie von Pumpen bezogen wurde. Statistisch wird die gespeicherte elektrische Energie und die erstmalig erzeugte Energie gesondert erfasst und ausgewiesen.
In der Praxis werden verschiedene Typen von Wasserkraftwerken oft miteinander kombiniert, um die Effizienz zu steigern und Umweltauswirkungen zu minimieren. So ergänzen etwa Pumpspeicheranlagen klassische Speicherkraftwerke, indem sie sowohl den natürlichen Zufluss als auch zuvor hochgepumptes Wasser für die Stromerzeugung nutzen. Laufwasserkraftwerke profitieren wiederum von vorhandenen Wasserspeichern und der kontrollierten Wasserabgabe, was ihre Leistungsfähigkeit zusätzlich erhöht.
Turbinen in Wasserkraftwerken
Kaplanturbine
Das Laufrad einer Turbine gleicht einem Schiffspropeller. Der eintretende Wasserstrom wird von einem Leitwerk gelenkt, sodass er parallel zur senkrechten Welle auf drei bis sechs verdrehbare Schaufeln des Laufrades trifft. Die Flügel des Turbinenlaufrads sind verstellbar. Dadurch kann die Turbinenleistung an das Flusswasserangebot angepasst werden. Die Kaplanturbine wird bei einer Fallhöhe von drei bis achtzig Metern und relativ großen Wasserdurchflussmengen eingesetzt (Laufwasserkraftwerke). Für den Einsatz in Laufwasserkraftwerken entwickelte der Schweizer Arno Fischer die Rohrturbine, eine horizontale Anordnung der Kaplanturbine. Hier bilden Generator und Turbine, angeordnet in einem geschlossenen Stahlgehäuse, eine platzsparende Einheit. Bei geringen Fallhöhen von zwei bis zehn Metern können Leistungen bis zu 80 MW erreicht werden.
Francisturbine
Bei der Francisturbine wird das Wasser durch ein feststehendes „Leitrad“ mit verstellbaren Schaufeln auf die gegenläufig gekrümmten Schaufeln des Laufrads gelenkt. Da das Wasser vor dem Eintritt in die Turbine unter höherem Druck steht als nach dem Austritt, spricht man auch von einer Überdruckturbine. Dieser Turbinentyp wird in Laufwasserkraftwerken, vor allem aber in Speicher- und Pumpspeicherwerken bei Fallhöhen bis 700 m eingesetzt.
Peltonturbine
Bei dieser Turbine trifft das Wasser aus der Düse tangential auf das mit bis zu 40 Bechern bestückte Laufrad. Mit dieser Turbinenart können Fallhöhen zwischen 100 m und 2.000 m genutzt werden. Sie ist typisch für Speicherwasser-Kraftwerke im Hochgebirge.
Vorteile der Wasserkraft
Wasserkraft bietet zahlreiche Vorteile für das deutsche Energiesystem: Die Stromerzeugung ist effizient, planbar, steuerbar und bewährt.
- Zuverlässig: Wasserkraftwerke sind jederzeit verfügbar und behaupten sich im Wettbewerb meist ohne Subventionen.
- Stabil: Wasserkraft trägt dazu bei, in einem Stromversorgungssystem mit einem zunehmenden Anteil aus erneuerbaren Energien die Versorgungssicherheit und Netzstabilität zu gewährleisten.
- Ausgleichend: Sie hilft, die schwankende Einspeisung von Solar- und Windenergie auszugleichen – insbesondere durch die Zwischenspeicherung in Pumpspeicherkraftwerken. Dadurch senkt die Wasserkraft nicht nur die CO2-Emissionen, sondern reduziert auch die volkswirtschaftlichen Kosten der Stromerzeugung.
Betreiber von Wasserkraftwerken unternehmen verschiedene Maßnahmen und Forschungsanstrengungen, um den guten ökologischen Zustand beziehungsweise das gute ökologische Potenzial der Oberflächengewässer in Deutschland zu erhalten bzw. zu erreichen.
Wasserkraftanlagenbetreiber tragen durch Naturschutzmaßnahmen an Wasserkraftwerken aktiv zur Verbesserung der Gewässerökologie bei und müssen dabei sowohl den Anforderungen des Naturschutzes als auch der Energieerzeugung gerecht werden, beispielsweise durch:
- Errichtung von Fischaufstiegsanlagen
- Renaturierung von Flussabschnitten
- Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur
- Initiativen zum Schutz wandernder Fischarten wie dem Aal